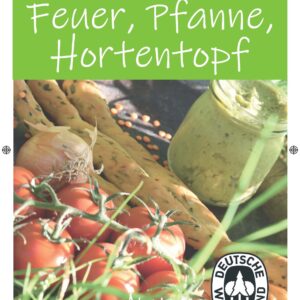Über den Jahreswechsel 2021/2022 hatte ich das Privileg mit 13 weiteren Menschen am Arktisprojekt der Deutschen Waldjugend teilzunehmen, welches bereits zum zweiten Mal durchgeführt worden ist. Am 25.12.2021 machte ich mich also mit dem Zug auf nach Hamburg, von wo aus die Reise einen Tag später mit dem Zug weiter nach Sápmi, weiter nach Kiruna und Abisko gehen sollte. In dem Rucksack auf meinem Rücken waren Wollpullover, in meinem geistigen Gepäck waren Fragen wie „Was macht es mit einer Region, die so lange als unerschlossen galt, jedoch aufgrund ihrer nun erreichbaren Ressourcen immer mehr internationale Aufmerksam erhält? Wie gehen die Bewohner dieser Region damit um, stehen sie im Konflikt zwischen Chancen auf ökonomische Entwicklung und Zerstörung der Umwelt und eines einzigartigen Lebensraumes? Was ist unsere Rolle dabei, wenn Deutschland schon jetzt einer Importabhängigkeit an Rohstoffen unterliegt und bereits jetzt einen großen Anteil der benötigten Rohstoffe aus Arktis-Anrain
In meinem noch jungen Leben durfte ich bereits lernen, dass der Weg, der einen wirklich weiterbringt, meistens der unkomfortable ist. Es ist der Weg, der die Dinge aus einer Position heraus betrachtet, die einem selbst in gewisser Weise die Unschuld an den Geschehnissen nimmt und wo Scheinheiligkeit oft ein bitteres Ende findet.
Als Symbol des Unkomfortablen könnte man auch unsere Zugreise sehen. Auch sie erscheint, verglichen mit einem Flug, unkomfortabel. Insgesamt hat es mehr als 100 Stunden, zwei mehr oder weniger geplante Zwischenübernachtung und dutzende umgeworfene Pläne gebraucht, um eine Strecke von knapp 6000 km zurückzulegen. Und doch bereue ich keine einzelne Stunde. Ich denke, dass es diese Zeit gebraucht hat, um das Erlebte auf mich wirken zu lassen und meine Gedanken und die neu gewonnenen Erkenntnisse im Ansatz zu ordnen. Es wäre mir darüber hinaus auch ausgesprochen zynisch vorgekommen, mit dem Flugzeug zu reisen und damit unnötig CO2 freizusetzen, um einen Ort zu bereisen, an dem die Klimakrise wahrlich nicht mehr zu leugnen ist.
Ein Eisenerzbergwerk in der Arktis? Bitte nicht.
Von Deutschland aus betrachtet erscheinen die Dinge oft schwarz-weiß. Man betrachtet die Dinge oft einseitig und mit voreingenommenen Augen, die Klimakrise und der Naturschutz stehen ausschließlich im Vordergrund, wir verurteilen, ohne alle Fakten zu kennen und alle Seiten zu beleuchten. Auch ich kann mich davon nicht freimachen. Habe ich doch vor der Reise die Eisenerz-Mine in Kiruna mit dem Braunkohleabbau in Deutschland verglichen und eine feste Meinung dazu gehabt. Doch so einfach sind die Dinge nicht.
Die Mine in Kiruna gilt als die größte der Welt. Mittlerweile wird bis in eine Tiefe von 1365 Metern jeden Tag eine Menge an Eisenerz abgebaut, die sechsmal dem Eifelturm entspricht. Die Erzbahn und die Wagons, die das abgebaute und in kleine Kugeln geformte Material von Kiruna zum nächsten Hafen transportieren, sind ein fester Bestandteil des Landschaftsbildes.
Fast jeder Einwohner hat in irgendeiner Art und Weise mit dem Bergwerk zu tun. Die LKAB (kurz für Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag), welche zu 100% dem Staat gehört, stellt den größten Arbeitgeber dar.
Während unseres Aufenthaltes in Kiruna kommen wir in Arbeiterwohnungen von LKAB unter. Morgens auf meinem Weg ins Nebengebäude begegnen mir Arbeiter auf dem Weg in die Grube. Es sind junge Männer, ungefähr in meinem Alter. Diese Männer gehören zu den bestverdienenden jungen Leuten in ganz Schweden, sie verdienen fast doppelt so viel wie im Landesschnitt. Von ihnen kann sich wahrscheinlich keiner vorstellen in naher Zukunft arbeitslos zu werden. Schwere Arbeit, aber ein fairer Lohn und Sicherheit, denn die Arbeitslosenquote bei jungen Leuten ist in Kiruna so niedrig wie in kaum einer anderen schwedischen Kommune. Wir grüßen uns kurz, für sie geht es auf die Arbeit, für mich geht es zum Frühstück.
Während ich mit dem aus Metall gefertigten Löffel die Hafermilch in meinem Kaffee umrühre, komme ich endgültig ins Grübeln. Wie naiv war ich eigentlich? Habe ich mich doch in der Vergangenheit tatsächlich ein Stück weit überlegen gefühlt, wenn ich mich gegen den Plastik- und für den Metalllöffel entschieden habe, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, woher das dafür essenzielle Eisenerz kommt. Was gab mir das Recht, respektlos über die Menschen hier zu denken? Ist es so verwerflich, ein vermeintlich sicheres Leben führen zu wollen und bin nicht auch ich ein stückweit dafür verantwortlich, dass hier Eisenerz abgebaut wird, da auch ich Dinge aus Metall nutze? Auch der Vergleich von Kiruna mit Braunkohleabbaugebieten in Deutschland verblasst nach und nach. Die Stadt Kiruna ist einzig und allein entstanden, da es dort erhebliche Vorkommen an Eisenerz gibt. Ohne Mine würde es keine Arbeitsstellen geben und ohne Arbeitsstellen keine Stadt. Ohne LKAB, kein Kiruna.
Die Grube ist die Ernährerin der Stadt, jedoch nicht ohne ihren Preis. Bei unserer Besichtigung lernen wir, dass im Juni 2010 eine Erweiterung des Abbaus in Richtung Norden beschlossen wurde. Dorthin, wo jetzt noch Menschen leben. Für die Stadt bedeutet dies, dass der betroffene Stadtteil abgerissen und einige Kilometer weiter östlich wieder aufgebaut wird. Aus diesem Grund ist auch eine seltsame Stimmung des Aufbruches in der Stadt zu verspüren. Ein paar der bedeutesten Gebäude der Stadt ziehen um, darunter die von LKAB gesponserte Kirche. Ein Großteil der Häuser wird jedoch abgerissen. LKAB baut neue Häuser, zahlt den Umzug. Am letzten Tag besuchen wir das neue Rathaus, vor ihm steht der Turm des alten Rathauses. Er steht da, wie ein Mahnmal für die Vergänglichkeit. Der Mensch hat sich einen neuen Lebensraum geschaffen, die Natur kann jedoch nicht einfach umsiedeln.
Ewiges Eis? Schnee von gestern.
Was für erhebliche Eingriffe der Mensch schon auf die Natur getätigt hat, erleben wir auch in Abisko, dem zweiten Teil unserer Reise.
Der Ort ist in der breiten Bevölkerung für die hohe Chance Polarlichter zu erblicken bekannt. Vielleicht kennt ihn manch einer auch durch die Abisko-Serie der Outdoorbekleidungsmarke Fjällräven. Was den wenigsten jedoch bekannt ist, ist der gleichnamige Nationalpark, der von Bergketten im Süden und dem Torneträsk-See im Norden gesäumt wird.
Am Rande ebendieses Sees stehe ich nun. Es ist der siebtgrößte See Schwedens, im Süden frisst sich die Europastraße 10 durch die Landschaft und auch hier rattern die mit Eisenerz beladenen Züge unaufhörlich vorbei. Es ist 13 Uhr, in einer Stunde wird es dunkel sein, die Sonne wird noch lange nicht aufgehen. Vor mir liegt eine schier endlos wirkende weiße Fläche. Eigentlich sollte die Landschaft karg und trostlos aussehen, jedoch ist sie das genaue Gegenteil dessen. Sie wirkt kraftvoll, unberührt, aller Widrigkeiten trotzend. Und doch weiß ich, dass dies nur eine Illusion ist. Die Natur ist durch die Klimakrise erheblich geschwächt, selten ist es mir so deutlich geworden, wie hier. Vielleicht habe ich mich an das Bild der geschwächten Natur in Deutschland insgeheim schon gewöhnt. Dieses Jahr ist der See gefroren, im Winter 2017/18 war er es das erste Mal seit Menschengedenken nicht mehr. Das Bild vom ewigen Eis ist Schnee von gestern. Herrschten in Kiruna noch Temperaturen von um die -25°C, sind es hier lediglich behagliche -6°C. Betrachtet man die Berge ringsum erkennt man, dass diese ungewöhnlich warmen Temperaturen nicht erst dieses Jahr herrschen, denn die Baumgrenze liegt schon deutlich höher, als es eigentlich der Fall sein sollte. Die obersten Reihen werden dabei durch ausschließlich junge Bäume geprägt, ein Zeichen dafür, dass das Vorrücken der Vegetation in höhere Lagen erst ein junges Phänomen sein kann. Ein Anflug von Ausweglosigkeit macht sich in mir breit. Mir wird bewusst, dass es für manche Dinge bereits jetzt zu spät ist, dass manche Dinge nie wieder rückgängig gemacht werden können. Meine Gedanken werden unterbrochen durch eine Gruppe Touristen, die gerade an den Rand des Sees tritt. Ich frage mich, ob sie sich gerade auch solche Fragen stellen. Ob sie noch beruhigt schlafen können und ob ich es in Zukunft noch kann oder ob auch sie durch Gedanken dieser Art wachgehalten werden.
Es ist ein anderer Tag, kurz nach 17 Uhr. Wir schnallen uns die Schneeschuhe an die Füße und die Stirnlampen über die Mützen. Langsam bahnen wir uns unseren Weg an den Zwingern der Schlittenhunde vorbei, raus aus der Siedlung. Der Schnee knirscht unter unseren Füßen. Mit jedem Schritt, den wir uns weiter weg von den Lichtern Abiskos bewegen eröffnet sich uns eine Welt, die dem inneren Bild, welches ich von der Arktis hatte, immer ähnlicher wird. Wir geben dem Drang uns in den Schnee zu legen nach. Über uns strahlt die Milchstraße, ringsherum ist alles bis auf den Wind, der uns um die Ohren pfeift, ruhig. Erst durch meine kalten Hände merke ich, dass einiges an Zeit verstrichen sein muss. Auf dem Rückweg wird mir bewusst, was für ein Glück ich habe, dass ich das noch erleben darf. Ich empfinde Mitleid für meine Nachkommen, die vielleicht schon nicht mehr die Möglichkeit dazu haben werden.
In der Unterkunft angekommen machen wir uns erstmal dran Abendessen zu kochen, meine Gedanken und Fragen rücken für eine Weile in den Hintergrund. Beim Abwaschen wird es plötzlich hektisch- draußen sind Polarlichter zu sehen!
Ich frage mich, ob wir Menschen nicht schon ein ganzes Stück weiter wären, wenn wir das gleiche Engagement für das Lösen der Klimakrise aufbringen würden, wie wir es für das Suchen und Fotografieren der Polarlichter aufbringe- und stapfe weiter den Weg hoch zum Helikopterlandeplatz, um die beste Sicht auf die tanzenden Lichter des Nordens zu haben.
Das Ende ist der Anfang.
„Laut Definition wird als „Arktis“ das gesamte Gebiet zwischen dem Nordpol und dem Polarkreis bezeichnet. Dies umfasst eine Fläche von 21 Millionen Quadratkilometern, sie ist somit größer als der russische Staat. Auf ihr sollen insgesamt ein Fünftel der verbleibenden Ressourcen an Erdöl und Erdgas, sowie Gold, Silber, Erz, Nickel und Kohle lagern. Und das Erschreckende an der ganzen Sache ist: Ich weiß so gut wie nichts über die Vorgänge in dieser Region.“ Dies waren die Worte, mit denen ich meine Bewerbung für das Arktisprojekt begonnen habe. Das war im Herbst 2019, vor meinem Studium, vor Corona und doch hatten die Worte nichts an ihrer Aktualität verloren. Diese Reise gehört wahrscheinlich zu den Dingen, an die auch noch im hohen Alter denken werden. Durch sie habe ich einige neue Erkenntnisse gewinnen und meinen Horizont ein Stück weit erweitern dürfen. Verstehen und begreifen- kann man das überhaupt in seiner vollen Gänze? Ich weiß es nicht.
Was ich aber weiß ist, dass wir dabei sind Landschaften, Lebensräume und Zukunftsaussichten zu verlieren, die es so nie wieder geben wird. Und jeder einzelne von uns steht dafür in der Verantwortung. Für manche Dinge mag es vielleicht schon zu spät sein, aber ich bin davon überzeugt, dass wir trotzdem noch etwas bewirken können, wenn wir endlich ins Handeln kommen.
-Annika Nelles
Die Bildungsreise wurde gefördert durch das Bundesprogramm „Aufholen nach Corona“.

Bild: Dennis Bindbeutel